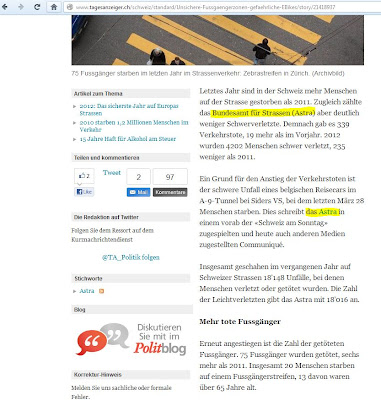Ich sammele sie immer separat in einer Wäschebox und alle paar Wochen sind sie dran, die Handtücher. Handtücher sind nämlich eine Wissenschaft für sich. Also, nicht das Handtuch an sich, aber der Umgang mit selbigen. Nee, auch nicht beim Abtrocknen, sondern beim Waschen. Eigentlich beim Waschen, Aufhängen und Abnehmen, Zusammenlegen und Wegpacken der Handtücher.
Das sage nicht ich, das trichterte mir Omma ein:
Dat is nemmich sone Sache.
Dat mit dem Waschen geht ja noch. Da kannze an sich nicht so viel bei falsch machen, begann sie ihren Lehrgang.
Bunte Hantücha aufn Haufen un weiße aufn andern. Wenn die nich mehr so schön sin, dann musse die bleichn, dann gehn die wieda. Schön heiß waschn, unter 60 °C geht da nix. Auch die buntn, die können dat ab. Wennse wat taugn. Bei Hantücha tusse bessa nich sparn, dat rächt sich nemmich späta. Un nich son billges Waschpulva nehm, lech wat an. Ich nehm Ariel, Persil geht vielleich au, abba nich vom Aldi, dat taucht nix.
Dann gehtet abba ers los mitti Maloche, warnte Omma an dieser Stelle,
am besten is, wennze die gewaschenen Hantücha nach draußn hängs. So richtig in Garten. Auffe Leine oda schön ordentlich anne Spinne. Damit die flattern können. Dann sind die fix trockn, riechn gut un behalt ihre Form. Die können auch bissken nass werdn und so richtich knackign Frost, der macht die Dinga schön muckelich.
Nun wurde es persönlich, an dieser Stelle setzte Omma immer demonstrativ den Zeigefinger vor meine Nase:
Un nie vergessn! Hantücha musse schlackern!! Imma!!! Abba ordntlich!!!! Volle Pulle, bisse dat inne Arme merks. Vorm und nachm Aufhängn. Hörsse? Wennze dat nemmich nich machs, dann reibs Dir naher die Fott wund. Un dat is nich schön, dat kannze ner alten Frau glaubn.
Also: Nasset Hantuch ausm Korb nehm, so richtich ausse Arme raus schlackern un ers dann aufhängn! Dat Schlackern gibt son Geräusch. Wennze dat nich hören tus, dann hasse nich richtich geschlackert und die Hantücha hängn rum wie welken Sallat. Un beim Abnehm wieda schlackern un dann zusammlegn. Auf Kante. So richtich akkerat.
Bügeln? Ach wat, wennze Handtücha ordentlich schlackern tus, dann brauchsse nix bügeln. Wirs sehn, wie schön dat in Dein Schrank aussehn tut. Un sach dat dem Oppa nich, abba ich tu ja imma noch Spritza Kölnisch Wasser oder Tosca bei. Dat riech ich so gerne.
Bei uns im Handtuchfach sieht es nicht aus wie in Omma ihrn Schrank. Wahrscheinlich fehlt doch Kölnisch Wasser. Oder Tosca. Oder mein Schweizer Ehegespons weiß nicht, wie man Handtücher richtig schlackert.
Und jetzt entschuldigt mich, ich muss zum Lehrgang. Damit der Mann das mit dem Schlackern endlich mal hinkriegt.
 |
| Omma würde mir das niemals durchgehen lassen. |
PS: Omma gab sich natürlich nicht mit dem Schlackern von Handtüchern zufrieden. Keine halben Sachen, alles, jedes einzelne Stück und Teil Wäsche, das aus der Waschmaschine kommt, muss geschlackert werden, aufgehängt, abgenommen und noch einmal geschlackert werden. Aber ordentlich.